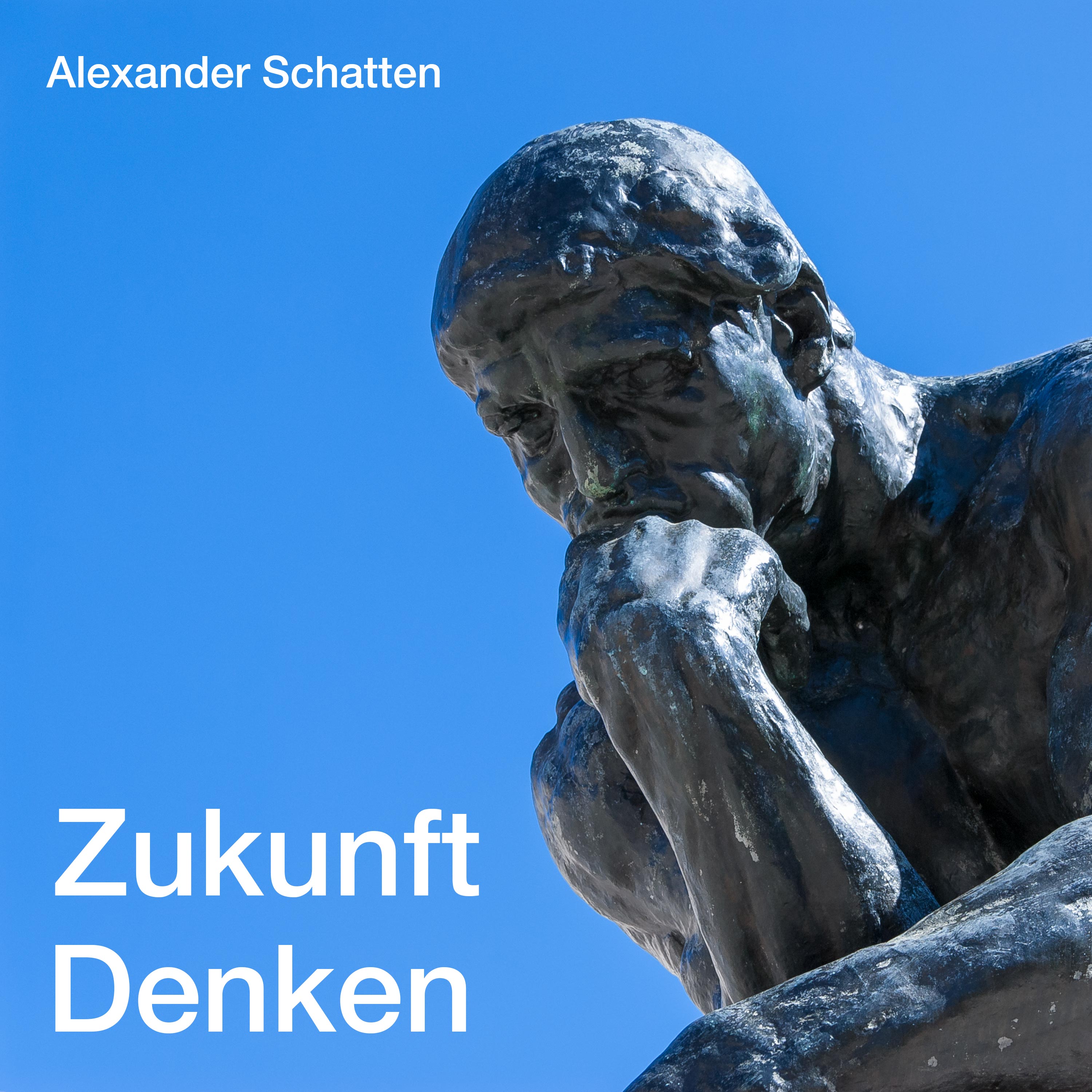Episodes

Wednesday Dec 31, 2025
143 — Auf Sand gebaut?
Wednesday Dec 31, 2025
Wednesday Dec 31, 2025
Ich habe in den vergangenen Jahren ja immer wieder mit Biologen über verschiedene Themen gesprochen, und eine sehr spannende Frage, die hier und da aufgetaucht ist lautet: was ist eigentlich die Definition von Leben? Oder anders ausgedrückt: wie können wir Leben von Nicht-Leben unterscheiden?
Aber gleich vorweg gesagt: diese biologische Frage ist faszinierend und leitet die Episode ein, ist per se nicht das Thema dieser Folge, sondern nur eines von mehreren Beispielen; wie etwa der Frage, was Wissenschaft von Nicht-Wissenschaft unterscheidet, was ist Intelligenz, was ist Energie und nicht zuletzt — was ist Pornographie?
Aber diese Beispiele dienen einer viel fundamentaleren Frage: wie kann ein wesentliches Gebäude gebaut werden, wenn das Fundament aus Sand besteht? Und kann dieses Gebäude überhaupt nützlich sein?
Zusammenfassend die Zitate dieser Episode:
NASA-Definition von Leben
“Life is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution.”
Lee Cronin's Definition:
»Life is the universe developing a memory.«
Richard Feynman schreibt:
»It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy is. We do not have a picture that energy comes in little blobs of a definite amount. It is not that way. However, there are formulas for calculating some numerical quan-tity, and when we add it all together it gives ... always the same number. It is an abstract thing in that it does not tell us the mechanism or the reasons for the various formulas. «
Karl Popper:
»the belief in the importance of the meanings of words, especially definitions, was almost universal. The attitude which I later came to call “essentialism”«
»the principle of never arguing about words and their meanings, because such arguments are specious and insignificant.«
»This, I still think, is the surest path to intellectual perdition: the abandonment of real problems for the sake of verbal problems.«
Dwight D. Eisenhower:
»Plans are worthless but planning is everything«
Generalfeldmarschall Helmuth Karl Bernhard von Moltke:
»Kein Plan überlebt die erste Feindberührung«
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 137: Alles Leben ist Problemlösen
-
Episode 132: Fragen an die künstliche Intelligenz — eine konstruktive Irritation
-
Episode 129: Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston
-
Episode 123: Die Natur kennt feine Grade, Ein Gespräch mit Prof. Frank Zachos
-
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
-
Episode 85: Naturalismus — was weiß Wissenschaft?
-
Episode 83: Robert Merton — Was ist Wissenschaft?
-
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
-
Episode 75: Gott und die Welt, ein Gespräch mit Werner Gruber und Erich Eder
-
Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
-
Episode 55: Strukturen der Welt
-
Episode 49: Wo denke ich? Reflexionen über den »undichten« Geist
-
Episode 48: Evolution, ein Gespräch mit Erich Eder
-
Episode 14: (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 2
-
Episode 13: (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 1
-
Episode 6: Messen, was messbar ist?
-
Episode 2: Was wissen wir?
Fachliche Referenzen
-
Erwin Schrödinger, Was ist Leben, Piper (1989)
-
Karl Popper, Unended Quest, Routledge Classics (2002)

Saturday Nov 08, 2025
139 — Komfortable Disruption
Saturday Nov 08, 2025
Saturday Nov 08, 2025
Der Titel der heutigen Episode lautet: »Komfortable Disruption«. Komfortable Disruption ist eigentlich eine Verkürzung; genauer gesagt müsste der Titel lauten: »Komfortable evolutionäre Disruption«, aber das ist natürlich sperriger. Es hört auch wie ein Gegensatz an, und diese Provokation soll auch so sein. Evolution bedeutet graduelle Veränderung, jedenfalls aus Sicht des Genotyps; also aus Sicht der Bauform, die Auswirkungen können recht erheblich sein.
Mein neues Buch:
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
kann vorbestellt werden!
Disruption bedeutet aber einen Umbruch, bei dem sich sehr viel in relativ kurzer Zeit verändert. Wie kann beides zusammengehen? Oder noch genauer: warum muss vermutlich beides zusammengehen?
Und noch wichtiger: was hat das mit Komfort zu tun? Ich versuche in dieser Episode zwei Dinge zu erreichen:
(1) Ein paar Einsichten, zu denen ich in den vergangenen Monaten gelangt bin, teilen, weil diese wirklich coole Beobachtungen über Form, Weg und Geschwindigkeit von Innovationen sind, die vielen nicht bewusst sind und auch mir in Tiefe und Breite nicht klar waren; da werde ich einige Beispiele nennen.
(2) Daraus abgeleitet ein paar Fragen, was wir von diesen Beobachtungen für die heutige Zeit und die Zukunft lernen können, und zwar sowohl in der Beobachtung und Interpretation dessen, was um uns herum passiert, aber auch, was das für Geschwindigkeit und Form von Innovationen in der Zukunft bedeuten könnte.
Wir stellen in dieser Episode die Frage, was die TAP-Theorie (Theory of the Adjacent Possible) damit zu tun hat, warum jeder Alexander Bell als Erfinder des Telefons kennt, Elisha Gray aber unbekannt geblieben ist.
Die wichtigste Frage aber ist: was geschieht beim Übergang vom Alten zum Neuen und was hat es mit Mimetic Ornamentation (Mimesis) zu tun?
»universal human reaction to technological change: the tendency to reproduce in new materials and techniques shapes and qualities familiar from past usage, regardless of appropriateness. This tendency may be called the principle of mimesis.«, Roger Scruton
Ich schildere dies anhand einer Reihe von wirklich faszinierenden Beispielen:
- Architektur in der Antike
- Entwicklung der Eisenbahn und des Autos
- Kleidung
- Fenster und Fassaden
- Holz-Konstruktionen und deren Echos in die Gegenwart
- Skeuomorphismus in der Software

Zugabteil aus der Mitte des 19. Jahrhunderts (Modell, Technisches Museum Wien)
Was sind die treibenden Kräfte für dieses Mimikri, diese mimetischen Ornamente und vergleichbarer Phänomene?
»People have generally tended to resist change; they find it reassuring to be surrounded by known and familiar forms. Reproducing them as ornament on newly introduced forms is a common reaction to the vague feeling of uneasiness that rapid social and technological change induces; it provides a satisfying sense of continuity between the past and the present.«, Roger Scruton
Aber es ist nicht nur der Widerstand gegen Neues, es gibt noch eine Reihe von anderen Gründen, warum sich Innovation älterer (Design-)Elemente bedient. Welche sind das?
Was treibt nun diese Mimikri? Warum ist das wichtig, relevant? Was können wir aus diesen Beobachtungen über Innovation lernen, die Geschwindigkeit von Veränderung und die Frage, ob es uns gelingen kann oder wird, die Stagnation der letzten Jahrzehnte zu überwinden.
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 136: Future Brunels? Learning from the Generation that Transformed the World. A Conversation with Dr. Helen Doe
-
Episode 128: Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet!
-
Episode 125: Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
-
Episoce 124: Zeitlos
-
Episode 123: Die Natur kennt feine Grade, Ein Gespräch mit Prof. Frank Zachos
-
Episode 110: The Shock of the Old, a conversation with David Edgerton
-
Episode 104: Aus Quantität wird Qualität
-
Episode 99: Entkopplung, Kopplung, Rückkopplung
-
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
-
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
-
Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens
-
Episode 65: Getting Nothing Done — Teil 2
-
Episode 64: Getting Nothing Done — Teil 1
-
Episode 35: Innovation oder: Alle Existenz ist Wartung?
-
Episode 18: Gespräch mit Andreas Windisch: Physik, Fortschritt oder Stagnation
Fachliche Referenzen
- Kevin Kelly, What Technology Wants, Penguin (2011)
- Marina Cortes, Stuart A. Kaufman, Andrew R. Liddle, Lee Smolin, The TAP equation: evaluating combinatorial innovation inbiocosmology (2025)
- Roger Scruton, Mimetic Ornamentation (Britannica)
- Rupert Riedl, Die Strategie der Genesis, Piper (1984)
- Holzarbeiten, Panele: The Amazing Invisible Detail (Youtube)
- Benz Patent-Motorwagen (1886)
- Stadtmuseum Coburg: Flocken Elektro Wagen (1888)
- »Livet kan kun forstås baglæns, men det må leves forlæns.«, Soren Kierkegaard, aus seinen Tagebüchern (1843)
- Leonard E. Read, I, Pencil (1958)

Sunday Oct 12, 2025
137 — Alles Leben ist Problemlösen
Sunday Oct 12, 2025
Sunday Oct 12, 2025
»There are no solutions, only trade-offs«, Tom Sowell
Dieses aus meiner Sicht herausragend wichtige Zitat ist leider nicht gut ins Deutschen zu übersetzen. Ich versuche es in dieser Episode zunächst mit einer Umschreibung und dann mit einer provokanten Theorie des Fortschrittes.
Gibt es bei komplexen Problemen also keine Lösungen, sondern werden immer neue Probleme aufgeworfen, andere Systeme schlechter gemacht, oder neue systemische Folgen nach sich gezogen? Man verbessert also an einer Seite und verschlechtert an einer anderen. Aber Moment — hört sich das vielleicht schlechter an, als es in der Tat ist?
Mein neues Buch:
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
kann vorbestellt werden!
In dieser Folge ein paar kurze Gedanken dazu, ich in Bezug gesetzt zu früheren Episoden. Wie immer bei diesen kurzen Monologen: es ist eine Anregung zum Nachdenken und Kritisieren; und wenn sie kritisieren, machen Sie das bitte laut, sodass ich es auch höre, z.B. auf X; oder wenn Sie es leider mögen, gerne auch via E-mail.
Was passiert bei komplexen Problemen? Was sind Wicked Problems? Treten neue Probleme auf derselben oder auf höheren systemischen Ebenen auf und was sind die Folgen für Fortschritt?
»Je größer die Unsicherheit ist, umso einfacher muss man die Regulierung [oder das Modell] machen.«, Gerd Gigerenzer in Episode 122
Wenn »Lösungen« ein Problem reduzieren aber andere, neue Probleme höherer Komplexität schaffen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft?
»If we would do nothing, we would also be surprised by unpredictable developments. […] We solved the problems that were existential and created better problems and level up. […] I prefer those problems to the ones that made life nasty, brutish and short.«, Johan Norberg in Episode 107
Und zum Schluss: sind bestimmte »Lösungen« alternativlos, wie etwa in Politik oder Aktivismus gerne behauptet wird, oder ist die Situation doch etwas komplizierter und weniger logisch?
»The opposite of a good idea can be another good idea.«, Rory Sutherland
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 136: Future Brunels? Learning from the Generation that Transformed the World. A Conversation with Dr. Helen Doe
-
Episode 129: Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston
-
Episode 125: Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
-
Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer
-
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 99: Entkopplung, Kopplung, Rückkopplung
-
Episode 94: Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg
-
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
-
Episode 72: Scheitern an komplexen Problemen? Wissenschaft, Sprache und Gesellschaft — Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
-
Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
-
Episode 27: Wicked Problems
Fachliche Referenzen
- Karl Popper, Alles Leben ist Problemlösen, Piper (1996)
- Thomas Sowell, A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles (1987)
-
Rory Sutherland, Alchemy, WH Allen (2021)
- Rory Sutherland, We have a Meeting
- 10 Rules of Alchemy by Rory Sutherland

Tuesday Sep 09, 2025
134 — Das Werdende, das ewig wirkt und lebt? Transzendent oder Transient
Tuesday Sep 09, 2025
Tuesday Sep 09, 2025
Dies ist wieder eine kurze Episode der konstruktiven Irritation. Ich möchte ein paar Gedanken teilen und wieder möglichst wenig eigene Wertung geben, sondern mögliche Aspekte aufzeigen und Fragen stellen. Selbstverständlich wird es auch diesmal nicht vollständig sein, aber hoffentlich zum Weiterdenken anregen.
Mein neues Buch:
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
kann vorbestellt werden!
Der erste Teil des Titels »Das Werdende, das ewig wirkt und lebt?« ist ein Zitat aus Faust I, am Ende werde ich das zum Ausklang etwas weiter zitieren. Das Thema ist also das Wechselspiel zwischen transendenten und trasienten Dingen und Ereignissen, beziehungsweise auch das Übergehen von einem ins andere.
Transzendet bedeutet dabei in meiner Verwendung, das Überschreiten oder Hinausgehen über bestimmte Grenzen. Etwas konkrete meine ich hier zwei Dimensionien: zeitlich, also Dinge, die über den Zeithorizont etwa eines Menschen oder einer Generation gehen sowie in einem materiellen Sinne; also Dinge die das materielle transzendieren, also überschreiten. Das kann eine spirituelle Bedeutung haben, aber auch eine philosopische, etwa nach Kant. Denken wir an Dinge, die jenseits der Erfahrung und des Verstands existieren oder etwas banaler, solche die nicht materiell greifbar sind, aber dennoch von Dauer. Ich werde das gleich anhand einiger Beispiele deutlicher machen.
Transient ist nun fast das Gegenteil, also Dinge oder Ereignisse, die relativ schnell vergehen, die also im Moment sind und wenig bleibende Spuren hinterlassen. Dies kann sich, wie gesagt, sowohl auf materielle wie auch geistige Aspekte beziehen.
Mich beschäftigt dieses Thema nun seit einiger Zeit, weil ich glaube, dass in menschlichen Kulturen sowie im individuellen Erleben diese Aspekte der Transzendenz oder des Vergehens sehr bestimmende Faktoren sein können, ohne dabei jetzt eine konkrete Wertung einbringen zu wollen. Und zwar darum, weil diese von der konkreten Ausprägung aber auch von den individuellen Werten abhängig ist.
In dieser Episode werde ich versuchen, diese Spannung an einer Reihe von Beispielen deutlich zu machen:
- Momente in der Zeit
- Theater- oder Musik-Aufführungen
- Bilder
- Kunst
- Gegenstände des Alltags
- Wissenschaft
- Philosophie — Karl Poppers Welt 3
- Mode und Kultur
- Gruppe vs. Individuum
Was geschieht mit Gesellschaften, die von Transzendenz dominiert sind, und mit solchen, die sie versuchen vollständig aus der Welt zu vertreiben und dann feststellt, dass viele Menschen ohne das Transzendente nicht leben können und sich dann aus dem Bauchladen der Beliebigkeit Themen suchen, die sie religiös überladen?
“Whatever the cause, a time horizon extending beyond the lifetime of the individual becomes a spontaneous moral control on individual action, analogous to moral constraints extending in space at a given time.”, Thomas Sowell
Wo stehen wir in der Welt? Wie gehen wir mit diesem Konflikt um?
»Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umfass euch mit der Liebe holden Schranken,
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Befestigt mit dauernden Gedanken!« , Faust I
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 128: Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet!
-
Episode 125: Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
-
Episoce 124: Zeitlos
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 98: Ist Gott tot? Ein philosophisches Gespräch mit Jan Juhani Steinmann
-
Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers
-
Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
-
Episode 76: Existentielle Risiken
-
Episode 66: Selbstverbesserung — ein Gespräch mit Prof. Anna Schaffner
-
Episode 57: Konservativ UND Progressiv
-
Episode 55: Strukturen der Welt
-
Episode 50: Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
-
Episode 49: Wo denke ich? Reflexionen über den »undichten« Geist
-
Episode 43: Deep Fakes: Wer bist du, und – was passiert da eigentlich?
-
Episode 26: Was kann Politik (noch) leisten? Ein Gespräch mit Christoph Chorherr
Fachliche Referenzen
- Alexander Schatten, Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise (2025)
- Johann Wolfgang von Goethe, Faust I (1808)
- Karl Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford University Press, Revised Edition (1979)
- Thomas Sowell, Knowledge and Decision, Basic Books (1996)

Monday Aug 18, 2025
132 — Fragen an die künstliche Intelligenz — eine konstruktive Irritation
Monday Aug 18, 2025
Monday Aug 18, 2025
Was bringt die Zukunft der KI? Erleben wir gerade das Ende der Arbeit oder wird mit KI geradezu ein Ende der Stagnation (im Westen) eingeleitet? Wird uns KI befreien oder unterwerfen? Steht gar die Singularität vor der Tür?
All diese Fragen und Prognosen werde ich nicht beantworten, sondern werde vielmehr versuchen, sinnvolle Fragestellungen im Umfeld der KI zu entwickeln und versuchen sie in einen Kontext zu stellen.
Diese Folge wird also Fragen aufwerfen sie aber bewusst nicht beantworten. Es ist der Versuch (nach Ralph Ruthardt) einer konstruktiven Irritation. Sie soll helfen, zu neuen Ideen zu kommen, auch zu irritieren und zum Nachdenken anzuregen.
(Sollte ich die eine oder andere Frage doch versuchen zu beantworten, verzeihen Sie mir, dieser Podcast ist noch von Menschen, nicht von KI gemacht.)
Hörer werden unterschiedliche Antworten finden. Auch wird es zahlreiche Fragen und Aspekte geben, die ich nicht bedacht habe.
Teilen Sie Ihre Erkenntnisse und Kritik! Ein Posting auf X mit Referenz an mich wäre eine gute Möglichkeit, auch E-Mails sind gerne gesehen.
Hier noch einige Zitate aus der Episode im Original:
“big data all comes from the same place – the past.”, Rory Sutherland
“I said that he was my superior in observation and deduction. If the art of the detective began and ended in reasoning from an arm-chair, my brother would be the greatest criminal agent that ever lived. But he has no ambition and no energy. He will not even go out of his way to verify his own solutions, and would rather be considered wrong than take the trouble to prove himself right. Again and again I have taken a problem to him, and have received an explanation which has afterwards proved to be the correct one. And yet he was absolutely incapable of working out the practical points which must be gone into before a case could be laid before a judge or jury.”, Sherlock Holmes
“AI technology is exceptionally expensive, and to justify those costs, the technology must be able to solve complex problems, which it isn’t designed to do.”, Jim Covello
“the US is currently placing its money on one huge bet: that AI will unleash a productivity revolution so great it will ultimately re-start the economy it’s presently impeding.” […] “Over the same three years that the AI revolution has been in full swing, labour productivity has grown at barely 1% a year, maintaining a decades-long trend of declining growth across Western countries.”, John Rapley
»Die aufeinanderfolgenden neuen Waffensysteme zeichneten sich durch wachsende operative Schnelligkeit aus, beginnend mit operativen Entscheidungen […], und gerade diese wachsende Schnelligkeit brachte den prinzipiell unberechenbaren Zufallsfaktor ebenfalls ins Spiel. Das ließe sich wie folgt formulieren: ‘Unerhört schnelle Systeme begehen unerhört schnell Fehler.’ Dort wo Bruchteile von Sekunden […] entscheiden, ist es unmöglich, militärisch-strategische Gewissheit zu erzielen, oder anders: Man wird nicht mehr zwischen Sieg und Niederlage unterscheiden können.«, Stanislaw Lem
»Die Politiker der parlamentarisch regierten Länder bewältigten schon im vergangenen Jahrhundert nicht einmal alle Probleme des eigenen Staates, geschweige denn die Weltprobleme, und darum hatten sie Berater. […] Mit der Zeit nahmen sie Computersysteme zu Hilfe, und zu spät erkannte man, daß die Menschen zu Sprachrohren ihrer Computer wurden. Sie meinten, sie selbst seien es, die die Dinge überdenken und Schlüsse ziehen […]. Doch tatsächlich operierten sie mit einem vom Rechenzentrum vorfabrizierten Material, und dieses Material bestimmte die menschlichen Entscheidungen.«, Stanislaw Lem
“If the economy is an information-processing system, does that mean that every corporation is an artificial intelligence? If people are worried about out-of-control AI taking over the world and destroying everything, shouldn’t we have been trying to do something about them at least seventy years ago – and probably more like two hundred?”, Dan Davies
"The Czar himself is powerless against the bureaucratic body; he can send any one of them to Siberia, but he cannot govern without them, or against their will. The experience of imperial China was very much the same.”, John Stuart Mill
Referenzen
Weitere Episoden
-
Episode 129: Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston
-
Episode 128: Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet!
-
Episode 125: Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
-
Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer
-
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
-
Episode 119: Spy vs Spy: Über künstlicher Intelligenz und anderen Agenten
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 103: Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger
-
Episode 100: Live im MQ, Was ist Wissen. Ein Gespräch mit Philipp Blom
-
Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens
-
Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
-
Episode 65: Getting Nothing Done — Teil 2
-
Episode 64: Getting Nothing Done — Teil 1
Fachliche Referenzen
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Oxford Martin School, University of Oxford
-
Rory Sutherland, Alchemy, WH Allen (2021)
- Roger Penrose on AI and consciousness
- Arthur Conan Dolye, The Adventure of the Greek Interpreter, Strand Magazine (1893)
- John Rapley, Is the AI Bubble about to Burst? Unherd (2025)
- GEN AI: To Much Spend, Too Little Benefit? Goldman Sachs (2024)
- Stanislaw Lem, Waffensysteme des 21. Jahrhunderts (1983)
- Dan Davies, The Unaccountability Machine, Why Big Systems Make Terrible Decisions - and How The World Lost its Mind, Profile Books (2024)
- Jeff Bezos on (industrial) bubbles (YouTube)

Tuesday Jul 01, 2025
128 — Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet!
Tuesday Jul 01, 2025
Tuesday Jul 01, 2025
Ich war im April in England. Ich erzähle das nicht deshalb, weil ich jetzt einen neuen Reise-Podcast mache oder ihnen Urlaubsphotos zeigen möchte. Aber diese Reise war eingerahmt von zwei Themen: Isambard Kingdom Brunel und einem Abend des Spectator-Magazins mit Douglas Murray, der sein neues und sehr wichtiges Buch vorgestellt hat.

Isambard Kingdom Brunel vor der SS Great Western
Ich hatte eigentlich vor, eine schnelle Episode (?) zu dem Thema zu machen und über die Eindrücke zu plaudern und zum Nachdenken anzuregen— und dann sind es wieder mehr als zwei Monate intensiver Recherche und das Lesen von vier Büchern geworden, bis ich mich hier sozusagen eingeschwungen habe. Keine Minute davon war für mich allerdings verloren.
Sollten Sie, wie viele, den Namen Brunel noch nie gehört haben, umso besser: bleiben sie dran, ich garantiere ihnen, es wird eine faszinierende und vor allem inspirierende Geschichte, die zum Weiterdenken anregen wird.

SS Great Britain
Die heutige Episode steht für mich auch vor dem Hintergrund meiner Buch-Recherche vor allem was die Zeit des 19. Jahrhunderts betrifft und die Folgen für unsere moderne Zivilisation. Diese Recherche hat mich auf mehreren Ebenen beeindruckt und verändert, aber auch etwas ärgerlich gemacht, um ehrlich zu sein. Ich war überrascht, wie wenig ich über diese absolut transformative Zeit wusste, in der Schule gelernt habe und wie wenig dies in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Damit meine ich nicht nur die geschichtliche Dimension, sondern auch die Lehren, die man daraus ziehen kann und, wie ich denke, ziehen muss.
Welchen Pfad bin ich über die letzten sechs Jahre im Podcast gegangen? Bin ich schlauer geworden? Habe ich meine Ansichten verändert?
Welche unglaubliche Geschichte des Erfolgs und der Transformation zeichnet diese Generation von Erfindern und Unternehmern des 19. Jahrhunderts und was können (oder sollen?!) wir von ihnen lernen?

Sir Joseph Paxton
»Paxton war vor natürlich ein Gärtner, aber als Pionier unter den self made Männern der viktorianischen Ära gehörte er einer Generation an, die ihre Zeit als Übergang von der Vergangenheit in die Zukunft betrachtete und die Innovationen des Tages begrüßte.«
Wir begegnen einer Generation von Machern, nicht Raunzern und Defätisten.
»Wie viele seiner Zeitgenossen, schien er fähig zu sein, nahezu jede Aufgabe zu lösen.«

Crystal Palace im Hyde Park
Aber hilft uns dies in der heutigen Welt?
»Could our society produce another Brunel? It is difficult to see how.«, Steven Brindle
Das wäre ein unfassbarer Stillstand. Wollen wir uns mit einem solchen Gedanken zufrieden geben?
»One of the sad signs of our times is that we have demonized those who produce, subsidized those who refuse to produce, and canonized those who complain.«, Thomas Sowell
Sind wir eine von Ängsten erfüllte, stagnierende Gesellschaft geworden, vor allem in Europa?
»No Risk no fun, aber stärker: no Risk, no survival.«
Der Versuch, alle Risiken zu vermeiden wird selbst zum größten Risiko.
»Man kann mit den Ideen der Vergangenheit nicht in die Zukunft gelangen. Das Gestalten der Zukunft birgt Risiken und bringt Probleme mit sich. Diese Risiken nicht einzugehen legt aber noch viel größere Risiken offen.«
Und der Blick in die Vergangenheit stellt weitere Fragen: gab es je Zeiten, die sicher waren, in denen man ruhig und entspannt an der Zukunft arbeiten konnte?
»Human life has always been lived on the edge of a precipice. Human culture has always had to exist under the shadow of something infinitely more important than itself. If man had postponed the search for knowledge and beauty until they were secure, the search would never had begun. […]
Life has never been normal.«, C. S. Lewis
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 126: Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski
-
Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd
-
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
-
Episode 120: All In: Energie, Wohlstand und die Zukunft der Welt: Ein Gespräch mit Prof. Franz Josef Radermacher
-
Episode 117: Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer
-
Episode 110: The Shock of the Old, a conversation with David Edgerton
-
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 96: Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert
-
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
-
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
-
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
-
Episode 76: Existentielle Risiken
-
Episode 74: Apocalype Always
-
Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens
-
Episode 65: Getting Nothing Done — Teil 2
-
Episode 64: Getting Nothing Done — Teil 1
-
Episode 50: Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
-
Episode 35: Innovation oder: Alle Existenz ist Wartung?
-
Episode 29: Fakten oder Geschichten? Wie gestalten wir die Zukunft?
-
Episode 6: Messen, was messbar ist?
Photos
- Isambard Kingdom Brunel (Wikimedia)
- The Crystal Palace in Hyde Park for Grand International Exhibition of 1851 (Wikimedia)
- Joseph Paxton (Wikimedia)
- Launch of the SS-Great Britain (Wikimedia)
Fachliche Referenzen
- Steven Brindle, Brunel: The Man Who Built the World, W&N (2006)
- Isambard Brunel, The Life of Isambard Kingdom Brunel, Civil Engineer, Longmans, Green, And CO (1870)
- Helen Doe, SS Great Britain, Amberley (2022)
- Helen Doe, The First Atlantic Liner, Brunel's Great Western Steamship, Amberley (2020)
- Kate Colquhoun, A Thing in Disguise, The Visionary Life of Joseph Paxton, Fourth Estate (2012)
- Brunel And His Great Bridges
- C. G. Merridew, I. K. Brunel's Crimean War Hospital (2014)
- Douglas Murray, On Democracies and Death Cults: Israel and the Future of Civilization, Broadside (2025)
- Thomas Sowell, Ever Wonder Why?, Hoover Institution Press (2006)
- C. S. Lewis, Learning in Wartimes (1939)

Thursday Jun 19, 2025
127 — Nicht einmal die Schweiz ist neutral...
Thursday Jun 19, 2025
Thursday Jun 19, 2025
Der Titel dieser kurzen Episode ist »Nicht einmal die Schweiz ist neutral...«, was können wir dann von Wissenschaftern, Journalisten und anderen öffentlichen Denkern und Kommentatoren erwarten? Es ist aufs Neue eine Episode die zum Nachdenken und Widerspruch anregen soll.
Der Auslöser dieser Episode ist ein Tweet, wo mir vorgeworfen wurde, ich würde meiner Glaubwürdigkeit schaden, weil ich eine bestimmte Position in einer Sachfrage vertrete und einen diesbezüglichen Tweet retweetet hätte. Es geht hier nicht um diese Sache an sich, sondern um die dahinterliegende Frage, die ich für gerechtfertigt halte.
Zunächst einmal stellt sich die Frage: Ist Neutralität überhaupt ein Ziel?
Noch grundsätzlicher gedacht: Niemand ist neutral. Damit haben wir eine Überschneidung mit dem Titel der letzten Episode. Sie erinnern sich vielleicht an den Kohlenkeller. Das Zitat von Karl Popper lautete:
»Wissenschaft ist, wenn man schwarz gekleidet in einem dunklen Kohlenkeller nach einer schwarzen Katze sucht, von der man gar nicht weiß, ob sie existiert.«
Wie sollte eine solche Neutralität auch aussehen? Wozu dürfte ich mich äußern? Ist Neutralität auf der individuellen Ebene in Wahrheit unmöglich?
An dieser Stelle möchte ich wieder zwei meiner Lieblingszitate von Karl Popper aus dem Buch »Auf der Suche nach einer besseren Welt« aus dem Jahr 1987 bringen:
»Klarheit ist ein intellektueller Wert an sich; Genauigkeit und Präzision aber sind es nicht.« und »Wir dürfen nie vorgeben zu wissen, und dürfen nie große Worte gebrauchen«
Leider wird das oftmals nicht gemacht und Popper folgert:
»Das Verfahren – wo die Argumente fehlen, da ersetze man sie durch den Wortschwall – war erfolgreich.«
Wann und wie sollte man sich also in der Öffentlichkeit äußern? Welches Risiko eingehen? Verliert man Freunde oder Kollegen, wenn man seine Ansicht äußert? Was sagt das über unsere Gesellschaft? Sind wir in Geiselhaft einer kleinen, aber aggressiven und illiberalen Elite?
»When you are the smartes person in the room, you are in the wrong room.«
Aber es gibt nicht nur die individuelle Ebene. Gibt es einen fundamentalen und wichtig zu verstehenden Unterschied zwischen Individuum und Organisation/Gruppe? Was sollten wir hier bedenken?
»Strongly held convictions that are prior to research often seem to be a precondition for success in the sciences.«, Thomas S. Kuhn
Die Suche nach Erkenntnis und Wahrheit ist ein ewiger Kampf. Ein Kampf, der sich nicht delegieren lässt. Nur Diktatoren behaupten, dieses Problem lösen zu können; behaupten Organisationen zu haben, die Missinformation (was immer das konkret bedeuten soll) erkennen und verhindern.
Ich bin davon überzeugt, dass autoritäre, paternalistische und totalitäre Ideen immer schreckliche Folgen haben. Niemand ist neutral, niemand hat die Wahrheit gepachtet. Versuchen wir also, unsere unterschiedlichen Ansichten fundiert und nachvollziehbar darzustellen und in den kritischen Diskurs zu gehen.
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 126: Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski
-
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 117: Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer
-
Episode 116: Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 96: Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert
-
Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers
-
Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
-
Episode 1: Zukunft Denken – eine gemeinsame Reise
Fachliche Referenzen
- Karl Popper, Auf der Suche nach einer besseren Welt (1987)
- Thomas S. Kuhn, The Function of Dogma in Scientific Research, in A.C. Crombie, ed. Scientific Change: Historical Studies in the Intellectual, Social and Technical Conditions for Scientific Discovery and Technical Invention, From Antiquity to the Present. New York: Basic Books, pp. 347-69. (1963)

Thursday May 22, 2025
125 — Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
Thursday May 22, 2025
Thursday May 22, 2025
Was hat mich zu der heutigen Episode motiviert? Ich war eigentlich in der Nacharbeit der nächste Folge, da bin ich auf einen Artikel, genauer gesagt, eine Artikelserie aufmerksam gemacht worden. Und ich möchte in dieser Folge im Wesentlichen diesen einen Artikel zum Thema machen, weil er mich wirklich beeindruckt hat, und denke, dass er auch Sie zum Nachdenken anregen wird.
Bitte an Podcast-Umfrage (sehr kurz) teilnehmen!
Im Jahr 1958 veröffentlicht der britische Observer eine Artikelreihe zum Thema »Ist Fortschritt möglich«. Autoren in dieser Serie sind:
- C. P. Snow
- C. S. Lewis
- Jacquetta Hawkes
- J. Z. Young
- Arnold Toynbee
Zunächst steigen wir mit dem Artikel von C. P. Snow mit dem Titel »Man in Society« ein, um einen Kontext zu geben. Der Fokus liegt dann aber auf dem Artikel von C. S. Lewis mit dem Titel »Willing Slaves of the Welfare State«.
C. S. Lewis war Wissenschafter in Oxford und Cambridge war uns bis heute für seine Chroniken von Narnia bekannt ist. Er war außerdem ein Freund von J. R. R. Tolkien.
Hier in den Shownotes noch einige der verwendeten Originalzitate aus dem Artikel, die ich, wie immer selbst ins Deutsche übersetzt habe.
»Through luck we got in first with the scientific-industrial revolution; as a result, our lives became, on the average, healthier, longer, more comfortable to an extent that had never been imagined; it doesn’t become us to tell our Chinese and Indian friends that that kind of progress is not worth having.«, C. P. Snow
Die weiteren Zitate sind von S. S. Lewis:
»The desire here is for mere survival. Now I care far more how humanity lives than how long. Progress, for me, means increasing goodness and happiness of individual lives. For the species, as for each man, mere longevity seems to me a contemptible ideal.«
»I am more concerned by what the Bomb is doing already.«
»The H-Bomb a Red Herring: One meets young people who make the threat of it a reason for poisoning every pleasure and evading every duty in the present. Didn’t they know that, Bomb or no Bomb, all men die (many in horrible ways)? There’s no good moping and sulking about it.«
»Observe how the “humane” attitude to crime could operate. If crimes are diseases, why should diseases be treated differently from crimes? And who but the experts can define disease?«
»Two wars necessitated vast curtailments of liberty, and we have grown, though grumblingly, accustomed to our chains.«
»The modern State exists not to protect our rights but to do us good or make us good – anyway, to do something to us or to make us something. Hence the new name “leaders” for those who were once “rulers”. We are less their subjects than their wards, pupils, or domestic animals. There is nothing left of which we can say to them, “Mind your own business.” Our whole lives are their business.«
»If we are to be mothered, mother must know best. This means they must increasingly rely on the advice of scientists, till in the end the politicians proper become merely the scientists’ puppets. Technocracy is the form to which a planned society must tend. Now I dread specialists in power because they are specialists speaking outside their special subjects.«
»Let the doctor tell me I shall die unless I do so-and-so; but whether life is worth having on those terms is no more a question for him than for any other man.«
»On just the same ground I dread government in the name of science. That is how tyrannies come in.«
»The question about progress has become the question whether we can discover any way of submitting to the worldwide paternalism of a technocracy without losing all personal privacy and independence.«
»What assurance have we that our masters will or can keep the promise which induced us to sell ourselves?«
»The more completely we are planned the more powerful they will be. Have we discovered some new reason why, this time, power should not corrupt as it has done before?«
Referenzen
Andere Episoden
-
Episoce 124: Zeitlos
-
Episode 117: Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
-
Episode 76: Existentielle Risiken
-
Episode 74: Apocalype Always
-
Episode 73: Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters
-
Episode 72: Scheitern an komplexen Problemen? Wissenschaft, Sprache und Gesellschaft — Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
-
Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens
Fachliche Referenzen

Wednesday May 14, 2025
124 — Zeitlos
Wednesday May 14, 2025
Wednesday May 14, 2025
Der Titel der heutigen Episode ist »Zeitlos«. Wie komme ich darauf? Die Motivation für diese kurze Episode der Reflexion ist eine Reihe von Tweets. Der erste war von Axel Bojanowski, dem — wie ich meine — führenden Wissenschaftsjournalisten im deutschsprachigen Raum. Er schreibt:
»Der mit Abstand beste deutsche Wissenschaftspodcast ist Zukunft Denken«
Natürlich freut mich eine solche Empfehlung aus derartig berufenem Munde ganz besonders. Es spornt auch an, weiter hart an diesem Projekt zu arbeiten. Es gab dann aber noch eine Reaktion eines Hörers, der den Aspekt der Zeitlosigkeit der Episoden betont hat.
Das hat mich zum Nachdenken angeregt.
Der erste Aspekt von Zeit ist ein eher banaler, aber einer, auf den ich gerne kurz eingehen möchte. Ich bekomme immer wieder Zuschriften, wo sich Hörer öfter neue Folgen wünschen. Warum das schwierig ist, erkläre ich in aller Kürze.
Dann aber zu weiteren Aspekten der Zeitlosigkeit, die eher inhaltlicher Natur sind, denn dieser Kommentar hat mich zum Nachdenken gebracht zumal es einige Überschneidungen zu vorigen Episoden gibt. Was hat etwas das Zitat von Gerd Gigerenzer aus Episode 122
»Je größer die Unsicherheit ist, desto mehr Informationen muss man ignorieren.«
mit dem Zitat von Stafford Beer aus Episode 121 gemein?
»Information and Action are one and the same thing«
Zur Dimension der Informationsdichte kommt noch die Dimension der Zeit auf eine sehr interessante Weise hinzu. Je Größer die Unsicherheit, desto wichtiger ist also nicht nur die Auswahl der Parameter, der Daten, sondern auch die richtige Zeitlichkeit im Umgang mit dem Problem.
Was bedeutet dies für News? Für den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit komplexen Problemen?
»Die relevanten Information entstehen Wochen, Monate, bei aktivistischen Großereignissen wie etwa Covid auch Jahre später. Diese geht dann aber im Lärm des nächsten Events unter.«
Fortschritt und Entschleunigung haben aber eine durchaus interessante Gemeinsamkeit, wir Herfried Münkler bemerkt:
“...Chance des Reflexionsgewinns durch Entschleunigung: Man kann die Bedeutung beim Treffen von Entscheidungen über größere Zeitspannen zu verfügen kaum überschätzen. und diese Zeitspannengewinn hängt nun einmal am Übergang vom mündlichen zum schriftlichen.” […] »Man konnte nunmehr sehr viel komplexere Fragen zum Gegenstand von Beratungen machen, als das in den direkten partizipatorischen Formen der Antike möglich war. Und man konnte Herausforderungen und Probleme in längerfristigen Perspektiven ins Auge fassen.«
Sind wir immer am Puls der Zeit? Oder sind wir eher am Puls des Rauschens?
Warum gibt es keine Wissenschafts-News und warum ist es gerade in komplexen Zeiten wichtig, Abstand von schnellen Medien zu halten? Warum sind Bücher gerade in schnellen Zeiten von besonderer Bedeutung?

Wie kann man die Welt in Schichten verschiedener Geschwindigkeiten begreifen? Stewart Brand bezeichnet dies als Pace Layering:
»Build a thing too fast, and mistakes cascade.
Build a thing at the right pace, and mistakes instruct.
Build a thing too slow, and mistakes are forgotten, then endlessly repeated in the endless restarts.
For instance, with infrastructure:
Building a thing at the right pace steadily all the way to completion probably works best with:
Continuity of control
Protected and guided by continuity of oversight and
Guided by continuously monitored undersight—from workers and early customers.
Continuity is the key.«
Was aber machen wir mit Systemen — um wieder auf Stafford Beer zurückzukommen — deren tatsächlicher Zweck sich vom deklarierten Zweck entfernt hat?
Wir enden nochmals mit einem Zitat von Stewart Brand:
»Fast learns, slow remembers. Fast proposes, slow disposes. Fast is discontinuous, slow is continuous. Fast and small instructs slow and big by accrued innovation and by occasional revolution. Slow and big controls small and fast by constraint and constancy. Fast gets all our attention, slow has all the power.«
Was haben Sie mitgenommen? Schreiben Sie mir!
Referenzen
Podcast Umfrage — Bitte teilnehmen!
Andere Episoden
-
Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer
-
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
-
Episode 119: Spy vs Spy: Über künstlicher Intelligenz und anderen Agenten
-
Episode 104: Aus Quantität wird Qualität
-
Episode 99: Entkopplung, Kopplung, Rückkopplung
-
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
-
Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
-
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
-
Episode 49: Wo denke ich? Reflexionen über den »undichten« Geist
-
Episode 47: Große Worte
-
Episode 32: Überleben in der Datenflut – oder: warum das Buch wichtiger ist als je zuvor
Fachliche Referenzen
- Tweet von Axel Bojanowski (2025)
- Herfried Münkler, Verkleinern und entschleunigen. Die Zukunft der Demokratie? ARD (2022)
- Stewart Brand, Pace Layering: How Complex Systems Learn and Keep Learning (2018)
- Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They're Built, Penguin (1995)

Wednesday Apr 02, 2025
121 — Künstliche Unintelligenz
Wednesday Apr 02, 2025
Wednesday Apr 02, 2025
In dieser Folge steht das Thema »Künstliche Unitelligenz« im Mittelpunkt – ein Begriff, der aus einem Artikel aus dem Spectator stammt: Britain has become a pioneer in Artificial Unintelligence. Was genau verbirgt sich hinter dieser Idee?
»Artificial Unintelligence is the means by which people of perfectly adequate natural intelligence are transformed by policies, procedures and protocols into animate but inflexible cogs. They speak and behave, but do not think or decide.«
Wie werden aus Menschen mit natürlicher Intelligenz bloß unflexible Rädchen? Wir reflektieren die zunehmende Strukturierung und Standardisierung in Organisationen, um mit wachsender gesellschaftlicher Komplexität umgehen zu können. Ein Ausgangspunkt der Episode ist die Frage, warum wir in immer mehr Organisationen eine strukturelle und individuelle Inkompetenz erleben? Ein Zitat aus dem genannten Artikel fasst es treffend zusammen:
»‘I didn’t find anything in common in these cases,’ I said, ‘except the stupidity of your staff. I expected him to get angry, but he maintained a Buddha-like calm. ‘Oh, I know,’ he replied, ‘but that is the standard expected now.’«
Wie konnte es so weit kommen? Liegt es an der Industrialisierung, die laut Dan Davies in The Unaccountability Machine besagt:
»A very important consequence of industrialisation is that it breaks the connection between the worker and the product.«
Oder hat es damit zu tun, wie wir mit Überwältungung durch Information umgehen.
»When people are overwhelmed by information, they always react in the same way – by building systems.«
Sind Menschen, die individuell denken, in solchen Systemen eher hinderlich als hilfreich? Doch was passiert, wenn komplexe Probleme auftreten, die Flexibilität und Kreativität erfordern? Sind unsere Organisationen überhaupt noch in der Lage, mit unerwarteten Situationen umzugehen, oder arbeiten sie nur noch »maschinenhaft« nach Vorgaben – und das mit einem Maschinenverständnis des 19. Jahrhunderts? Ist die Stagnation, die wir seit Jahrzehnten spüren, ein Symptom dieses Systemversagens? Und wie hängt das mit der sogenannten »Unaccountability Machine« zusammen, die Davies beschreibt und die man im Deutschen vielleicht als »Verantwortungslosigkeits-Maschine« bezeichnen könnte? Kann es sogar sein, dass manche Strukturen bewusst als »self-organising control fraud« gestaltet sind?
Ein weiteres damit verbundenes Thema ist: Wie beeinflussen moderne Prognose-Tools wie Recommender Systems unser Verhalten? Dienen sie wirklich dazu, bessere Entscheidungen zu ermöglichen, oder machen sie uns hauptsächlich vorhersagbarer? »Menschen, die dies und jedes gekauft/gesehen haben, haben auch dies gekauft/gesehen« – ist das noch Prognose oder schon Formung des Geschmacks? Und was ist mit wissenschaftlichen Modellen komplexer Systeme, die oft relativ beliebige Ergebnisse liefern? Formen sie nicht auch die Meinung von Wissenschaftlern, Politikern und der Gesellschaft – etwa durch die überall beobachtbare schlichte Medienberichterstattung?
Bleibt außerdem der Mensch wirklich »in the loop«, wie oft behauptet wird, oder ist er längst ein »artificial unintelligent man in the loop«, der Empfehlungen des Systems kaum hinterfragen kann?
Die Episode wirft auch einen kritischen Blick auf naive Ideologien wie das »Scientific World Management« von Alfred Korzybski, der schrieb:
„it will give a scientific foundation to Political Economy and transform so-called ‘scientific shop management’ into genuine ‘scientific world management.’“
War dieser Wunsch nach dem Ersten Weltkrieg verständlich, aber letztlich völlig missgeleitet? Und warum erleben wir heute eine Wiederkehr des naiven Szientismus, der glaubt, »die Wissenschaft« liefere objektive Antworten? Wie hängen solche Ideen mit Phänomenen wie »Science Diplomacy« zusammen?
Die zentrale Frage der Episode lautet: Wie erreicht man, dass Menschen in Verantwortung korrekt im Sinne des definierten Zwecks der Organisation entscheiden? Doch was ist überhaupt der Zweck eines Systems? Stafford Beer sagt:
»The purpose of a system is what it does.«
Stimmt der definierte Zweck – etwa Gesundheit im Gesundheitssystem – noch mit der Realität überein? Warum entscheiden Ärzte oft defensiv im eigenen Interesse statt im Interesse der Patienten? Und wie überträgt sich dieses Verhalten auf andere Organisationen – von Ministerien bis hin zur Wissenschaft? Davies beschreibt das ab Beispiel des akademischen Publikationswesens so:
„A not-wholly-unfair analysis of academic publishing would be that it is an industry in which academics compete against one another for the privilege of providing free labour for a profitmaking company, which then sells the results back to them at monopoly prices.“
Und weiter:
„The truly valuable output of the academic publishing industry is not journals, but citations.“
Was ist aus der Idee geworden, dass die Generierung von neuem und relevantem Wissen die Aufgabe von Wissenschaft, Förderung und Publikationswesen ist?
Zum Abschluss stelle ich die Frage: Wie können Systeme so gestaltet werden, dass Verantwortung wieder übernommen wird? Wie balanciert man die Zuordnung von Konsequenzen mit der Möglichkeit, ehrlich zu scheitern – ohne Innovation zu ersticken? Und was sind »Luxury Beliefs« – jene modischen Ideen elitärer Kreise, die sie selbst nicht tragen müssen, während sie für andere zur existenziellen Bedrohung werden?
Die Episode endet so mit einem Aufruf zur Diskussion: Wie lösen wir diesen Spagat zwischen Verantwortung und Risiko in einer immer komplexeren Welt?
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 119: Spy vs Spy: Über künstlicher Intelligenz und anderen Agenten
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 117: Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer
-
Episode 116: Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 103: Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger
-
Episode 93: Covid. Die unerklärliche Stille nach dem Sturm. Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
-
Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
-
Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
Fachliche Referenzen
- Britain has become a pioneer in Artificial Unintelligence | The Spectator (2025)
- Davies, Dan. The Unaccountability Machine: Why Big Systems Make Terrible Decisions - and How The World Lost its Mind, Profile Books (2024)
- Alfred Korzybski, Manhood of Humanity (1921)
- Jessica Weinkle, What is Science Diplomacy (2025)
- Nassim Taleb, Skin in the Game, Penguin (2018)
- Rob Henderson, 'Luxury beliefs' are latest status symbol for rich Americans, New York Post (2019)
-
Lorraine Daston, Rules, Princeton Univ. Press (2023)